China verfolgt keine Strategie des offenen Systembruchs wie etwa Russland – stattdessen bemüht sich Peking, die bestehenden internationalen Strukturen gezielt zu nutzen, um eigene Interessen durchzusetzen. Offiziell gibt sich das Land als verantwortungsvolle Ordnungsmacht, während es zugleich die Regeln der westlich geprägten Weltordnung immer offener infrage stellt. Dieser doppelte Kurs offenbart ein Grundproblem: Der Aufstieg Chinas wurde durch die Zusammenarbeit mit dem Westen ermöglicht – gleichzeitig will das Land diesen Westen nun zunehmend herausfordern, ohne die Brücken völlig abzubrechen.
Der Druck auf Chinas Führung wächst: Politischer Gegenwind aus demokratischen Ländern, eine fragile Wirtschaftslage im Inland sowie der rigide Umgang mit der Pandemie haben deutliche Spuren hinterlassen. Ohne Zusammenarbeit mit dem Westen könnte Chinas Ziel, eine globale Führungsmacht zu werden, auf absehbare Zeit scheitern.
Auch innerhalb des Landes verschieben sich die Machtverhältnisse – und der Alltag der Menschen verändert sich spürbar. Was früher galt – wer sich politisch zurückhält, kann ein gutes Leben führen – scheint nicht mehr zu stimmen. Der Staat greift nun wieder tief in das Privatleben ein: Popkulturelle Vorbilder werden zensiert, weil sie angeblich nicht zum Idealbild der Nation passen. Sportler müssen ihre Tattoos verstecken. Kindern wird die Online-Spielzeit streng reglementiert. Selbst im Schulunterricht zeigt sich die neue Linie: In Shanghai wurde das Fach „Xi-Jinping-Denken“ eingeführt – auf Kosten des Englischunterrichts. Das wirft Fragen auf, besonders in einer globalisierten Welt, in der internationale Verständigung essenziell bleibt.
Blickt man auf die innere Struktur der kommunistischen Partei, zeigen sich tiefere Machtlinien. Zwei Fraktionen prägen die chinesische Führung maßgeblich. Auf der einen Seite stehen die sogenannten Jugendliga-Kader, also Politiker, die über den Kommunistischen Jugendverband aufgestiegen sind. Dieser Verband zählt zu den größten Organisationen des Landes und war lange ein klassischer Weg in höhere Ämter – auch für Persönlichkeiten wie Ex-Präsident Hu Jintao oder den kürzlich verstorbenen Premier Li Keqiang. Die Vertreter dieser Gruppe stammen meist aus einfacheren Verhältnissen und vertreten einen stärker sozial orientierten Kurs: mehr Gerechtigkeit, mehr Teilhabe, mehr gesellschaftlicher Ausgleich.
Auf der anderen Seite stehen die Prinzlinge – Kinder und Nachkommen jener Revolutionäre, die nach 1949 die Volksrepublik geprägt haben. Auch Xi Jinping gehört zu dieser Gruppe: Sein Vater gehörte in den 1980er-Jahren dem Politbüro an. Diese „rote Elite“ ist tief mit Staat, Partei und Wirtschaft verflochten. Ihre Politik setzt auf Stabilität durch Wachstum, Effizienz, und Kontrolle.
Beide Lager bekennen sich zum Sozialismus, vertreten aber sehr unterschiedliche Akzente. Während die einen auf wirtschaftliche Schlagkraft und technokratische Führung setzen, sehen die anderen die soziale Balance als Voraussetzung für langfristige Stabilität.
Wie es um die Zukunft von Xi Jinpings Macht steht, hängt letztlich nicht nur von ihm selbst ab. Entscheidend wird sein, welche dieser Gruppen – Eliten oder Jugendliga – in den Parteikadern darunter die stärkere Position gewinnt. Denn dort wird der politische Kurs der nächsten Jahre mitentschieden.
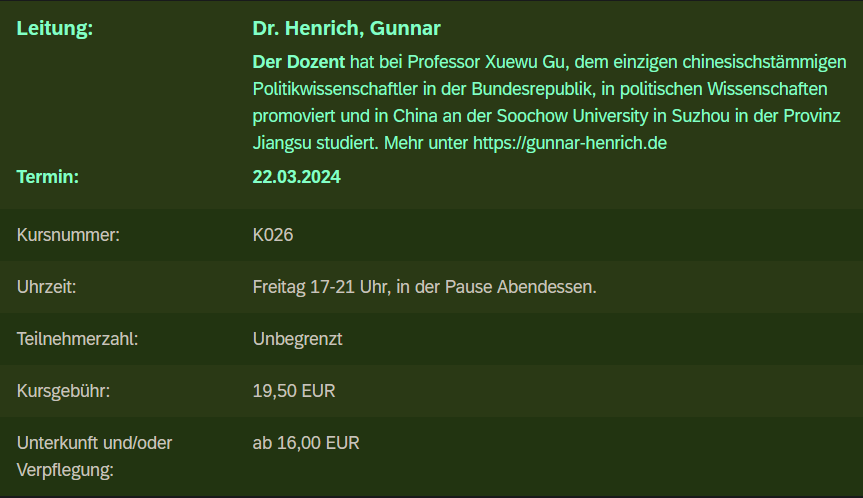
Neueste Kommentare